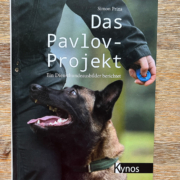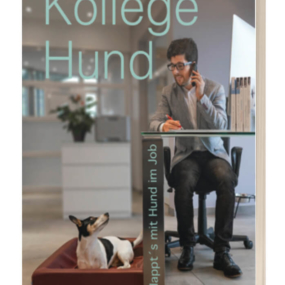Trainingsmethoden – Wer die Wahl hat, hat die Qual
Lernen und Trainingsprinzipien, Training & Verhalten
Bilder: Shutterstock
Die Themen Hundeerziehung und Hundetraining sind in den letzten Jahren sehr populär geworden. Ob im Fernsehen, in Zeitschriften oder sogar im Radio – es ist ein Thema, welches viele Menschen bewegt. Dies ist nicht verwunderlich, denn aufgrund der sich immer schneller entwickelnden Welt der Menschen wird es für Hunde oftmals auch schwerer, sich in dieser zurechtzufinden. Die Hundedichte in den Städten steigt stetig an. Dass dadurch bedingt problematische Situationen im Alltag mit dem Hund zunehmen können, liegt auf der Hand. Daher ist es begrüßenswert, wenn Menschen sich dazu entschließen, ihren Hund durch ein gutes und fundiertes Training zu unterstützen!
- Woran kann die Hundehalter:in eine gute Trainer:in oder Verhaltensberater:in für sich und ihren Hund erkennen?
- Wie soll die Hundehalter:in den Durchblick im Dschungel der Trainingsmethoden bewahren?
- Für welche der beworbenen Trainingsmethoden soll man sich entscheiden?
Man stößt auf Beschreibungen wie sprachloses Hundetraining, Rudelkonzept, Trainieren mit Energieübertragung, Raumverwaltung, Persönlichkeit statt Futterbelohnung, natürliche Hundeerziehung, Clickertraining, Kynologie, Hundepsychologie, artgerechte Hundeerziehung, Lernen ohne Konditionierung und viele mehr.
- Worin unterscheiden sich all diese Trainingsmethoden und Ansätze in der Hundeerziehung?
- Was sollte man bei der Auswahl einer Trainingsmethode beachten?
Wer wenig weiß, muss vieles glauben!
Daher möchte ich einen kleinen Ausflug in die Welt des Hundetrainings starten, um Ihnen ein paar Hintergründe aufzuzeigen, wie Training funktioniert. Ich werde versuchen, Fachbegriffe weitestgehend außen vor zu lassen. Mir ist es wichtig, dass Sie verstehen lernen und somit in der Lage sind, jede Trainingsmethode auf bestimmte Punkte hin zu prüfen. So wird es für Sie vielleicht einfacher, für sich und ihren Hund eine geeignete Trainer:in oder Verhaltensberater:in zu finden.
Ich habe das Glück, dass ich in Deutschland häufig auf deutschsprachige Menschen treffe. Möchte ich diesen Menschen etwas beibringen, ist es für mich recht komfortabel, meine Gedanken in Worte zu fassen. Mein Gegenüber hat es relativ leicht, meine Worte zu entschlüsseln, zu verstehen und meine Ideen umzusetzen. Sprechen mein Gegenüber und ich nicht dieselbe Sprache, wird das Ganze schon spannender, obwohl wir beide Menschen sind.
Nun haben wir vor uns unseren Hund der Deutsch nicht versteht und selber auch nicht in der Lage ist, in einer ähnlichen Sprache mit uns zu kommunizieren. Welche Möglichkeiten haben wir, ihm unsere Wünsche mitzuteilen? Wie können wir ihn dazu bringen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen?
Ein Hund lebt mitten in seiner Umwelt. In dieser Umwelt verhält er sich – immer. Verhalten ist fließend. Das Verhalten des Hundes wird beispielsweise angeregt durch innere Bedürfnisse und Befindlichkeiten wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Schmerzen, der Wunsch nach Sicherheit, die Suche nach Fortpflanzungspartnern und durch äußere Geschehnisse wie zum Beispiel das Auftauchen eines Artgenossen oder eines Rehs, Menschen, Autos, Geräusche und die Wetterlage. Verhalten entsteht im Gehirn und Emotionen spielen dabei eine große Rolle! Hunde verhalten sich mal schlafend, stehend, schnüffelnd, sitzend, an der Leine ziehend, bellend, knurrend, Pipi machend, jagend, fressend, liegend, spielend, räkelnd, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
Dadurch, dass Verhalten in der Umwelt geschieht, ist es mit Konsequenzen für den Hund verbunden. Diese Konsequenzen können aus der Umwelt kommen oder vom Hund selbst. Genaueres dazu werde ich noch erläutern.
Konsequenzen führen dazu, dass Verhalten bestehen bleibt und/oder häufiger gezeigt wird, da es sich lohnt, oder es weniger häufig auftritt, da es sich für das Lebewesen nicht lohnt. Dieses wurde erstmals von Edward Thorndike 1898- 1911 in seinem „Law of Effect“ beschrieben. Konsequenzen, die auf ein Verhalten folgen können, können in vier verschiedene Typen unterteilt werden. Dies sind die vier Konsequenzen der operanten Konditionierung, einer Form des individuellen Lernens, die im Training immer mit im Spiel ist.
Jede Art des Tiertrainings – vom Fisch über den Vogel zum Hund – macht sich diese Konsequenzen zu Nutze. Auch wir Menschen lernen über sie. Letztendlich müssen Sie sich diesen und folgende Begriffe nicht merken, aber es ist gut, sie zu verstehen und auch mal gehört zu haben. Vielleicht erinnern Sie auch an Momente aus Fernsehsendungen zum Thema Hundetraining, welche Sie mit Ihrem neuen Wissen den vier Konsequenzen der operanten Konditionierung zuordnen können.
Zwei der vier Konsequenzen sind Bestrafungstypen und dienen dazu, dass Verhalten schwächer wird und somit weniger vom Hund gezeigt wird. Bei den beiden anderen handelt es sich um Belohnungstypen, die Verhalten häufiger auftreten lassen.
KONSEQUENZ NUMMER 1 “POSITIVE BESTRAFUNG” (ÄNGSTIGENDE STRAFE):

Ein Hund zeigt ein Verhalten wie zum Beispiel an der Leine ziehen, wenn er einen anderen Artgenossen sieht, welchen er begrüßen möchte. Reagiert die Hundehalter:in auf das Ziehen an der Leine beispielsweise mit einem Leinenruck, dann wird der Situation etwas Unangenehmes (=Bestrafung) hinzugefügt (=positiv, im mathematischen Sinne). Im traditionellen, strafbasierten Hundetraining sind unangenehme Konsequenzen für den Hund desweiteren typischerweise der Leinenruck, ein Kneifen in die Lenden, das Werfen einer Klapperdose, das Bespritzen mit Wasser, laute Worte oder eine bedrohliche Körperhaltung der Hundehalter:in.
Strafen sollen Verhalten stoppen oder zumindest hemmen, so dass es vom Hund in Zukunft weniger häufig gezeigt wird. Sie wirken dadurch, dass sich der Hund erschrickt oder ihm Schmerzen zugefügt werden – kurz, das Sicherheitsbedürfnis des Hundes wird angesprochen. Sicherheit ist für ein Lebewesen enorm wichtig, denn wenn es zu spät auf eine Gefahr reagiert, kann es für das Lebewesen schon zu spät sein. Ein Grund, warum Lebewesen schnell darauf reagieren. Wir Menschen übrigens ebenso.
Aber egal, ob es „nur“ ein kurzer Schreck ist oder sogar ein Schmerz, es hinterlässt unangenehme Gefühle. Der Hund fühlt sich bedroht und empfindet Angst. Die Intensitäten sind je nach Grad der Bestrafung unterschiedlich.
Positive Bestrafung kann sehr effektiv sein. Das unerwünschte Verhalten muss sofort und immer dann bestraft werden, wenn es auftritt. Bestrafungen sollten auch tatsächlich Verhalten weniger häufig auftreten lassen. Muss man wiederholt strafen, ist die gedachte Bestrafung keine gewesen und die Hundehalter:in im Training wenig effektiv – der Hund jedoch sehr gestresst. Dieses lässt das Erregungsniveau steigen und macht unerwünschtes Verhalten noch wahrscheinlicher. Positive Bestrafung ist wenig effektiv bei angeborenem Verhalten.
Im Alltag sind die Regeln der effektiven Bestrafung oft schwer umsetzbar. Die Gefahr, dass hier Fehler seitens der Hundehalter:in gemacht werden, ist relativ groß. Dies ist problematisch, da das Trainieren mit positiver Bestrafung Angst steigern und auch aggressives Verhalten auslösen kann, wenn der Hund sich gegen die Bedrohung wehren und verteidigen möchte oder muss.
Eine weitere potentielle Nebenwirkung ist möglich, da das Gehirn des Hundes versucht, Unangenehmes zu vermeiden. Das Gehirn versucht dabei herauszufiltern, was kurz vor dem Unangenehmen geschehen ist oder wo sich der Hund zu diesem Zeitpunkt befunden hat, damit es beim nächsten Mal schneller auf eine Gefahr reagieren und sie abwenden oder ihr entfliehen kann. Hat das Hundegehirn abgespeichert, dass es vor der Strafe ein Kind gesehen hat, kann es passieren, dass beim nächsten Mal schon der Anblick eines Kindes ausreicht, um Angst- oder Aggressionsverhalten auszulösen, da es zur Vorhersage von positiver Strafe, zu einer Vorhersage von etwas Unangenehmen, geworden ist. Das Hundehirn kann dazu auch abspeichern, dass sich die Bezugsperson im Umfeld befunden hat. Wird die Bezugsperson des Hundes zur Vorhersage einer unangenehmen Konsequenz, ist der Hund im argen Konflikt.
Diese Nebenwirkung tritt nicht immer auf, aber man muss sich bewusst sein, dass es passieren kann, denn es ist biologisch sinnvoller, komplette Situationen abzuspeichern, da das Lebewesen sich so am besten vor potentiellen Gefahren schützen kann. Diesen Vorgang der Abspeicherung und die Verknüpfung von Emotionen mit den Situationen nennt man klassische Konditionierung. Sie wurde von Iwan Petrowitsch Pawlow entdeckt und beschrieben. Sie hat mit der operanten Konditionierung direkt nichts zu tun, aber dadurch, dass dieser Vorgang im Gehirn automatisch abläuft und der Hund darauf keinen Einfluss hat, ist sie ein ständiger Begleiter. Klassische und operante Konditionierung laufen immer parallel.
KONSEQUENZ NUMMER 2 “NEGATIVE BESTRAFUNG” (FRUSTRIERENDE STRAFE):
Negative Bestrafung bedeutet, dass der Hund bestraft wird, indem ihm etwas Angenehmes genommen wird (negativ), wenn er ein unerwünschtes Verhalten zeigt. Sie wirkt auch, wenn er aus einer Situation geführt wird, die ihm angenehm ist.
Bellt ein Hund, zum Beispiel um die Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson zu bekommen, kann er damit bestraft werden, dass man ihn in einen anderen Raum bringt, wo er alleine sein muss. Somit hätte der Hund die komplette Aufmerksamkeit seiner Menschen verloren. Ähnlich verhält es sich mit dem Tipp, einen Hund zu ignorieren, wenn er einen anspringt. Diese Art der Bestrafung funktioniert jedoch nicht, wenn der Hund einfach Spaß am Bellen oder Springen hat und die Ausführung des Verhaltens schon Belohnung genug ist.
Das Training über negative Bestrafung kann effektiv, aber für den Hund auch sehr frustrierend sein. Frustration lässt die Erregung deutlich steigen, wodurch aggressives Verhalten ausgelöst werden kann. Da der Hund sich aber nicht körperlich angegriffen fühlt wie bei der positiven Bestrafung, tritt eine verteidigende Aggression nicht auf.
Da die negative Bestrafung über Frustration arbeitet, kann sie nicht effektiv bei unerwünschtem Verhalten wirkungsvoll eingesetzt werden, wenn dieses aufgrund von Frustration entsteht.
Trainiert die Besitzer:in eines Hundes viel mit positiven Bestrafungen, kann es passieren, dass der Hund es als belohnend empfindet, wenn er kurz in einen anderen Raum geführt wird, wo er ohne seine Bezugsperson verbleiben darf. In diesem Fall würde die Besitzer:in des Hundes ein Bellen durch das räumliche Trennen sogar verstärken! Verstärken bedeutet, dass ein Hund ein Verhalten weiterhin, häufiger, intensiver, schneller oder länger zeigen wird, wenn die Konsequenz auf das gezeigte Verhalten vom Hund als belohnend empfunden wird.
KONSEQUENZ NUMMER 3 “NEGATIVE VERSTÄRKUNG” (ERLEICHTERNDE BELOHNUNG):
Möchte die Hundehalter:in ihrem Hund das Sitz beibringen, ist eine Methode, das Wort Sitz zu sagen, dann mit den Fingern auf das Hinterteil des Hundes zu drücken, während er mittels Leine in Position gehalten wird. Der Druck ist etwas Unangenehmes und der Hund wird versuchen, sich Erleichterung zu verschaffen und sich hinsetzen. Mit der Zeit wird er lernen, dass er sich bei dem Wort “Sitz!” lieber gleich hinsetzt, da er so dem Unangenehmen entkommen kann.
Ähnlich verhält es sich, wenn dem Hund das Signal für “Sitz” gegeben wird, er sich nicht gleich hinsetzt und dann, mit vielleicht sogar einer etwas einschüchternden Körperhaltung, auf ihn zugegangen wird. Die Distanz zum Hund wird unterschritten, es wird ihm unangenehm, er setzt sich hin und in dem Moment nimmt der Hundehalter sich wieder zurück und schafft Erleichterung.
Nutzt man die negative Verstärkung in dieser Art und Weise, wird der aufmerksamen Leser:in nicht entgangen sein, dass die Bezugsperson der Situation zuerst immer etwas Unangenehmes hinzufügen muss.
Zeigt ein Hund jedoch Angst- oder Aggressionsverhalten, da er sich in Gegenwart eines anderen Hundes, Menschen oder Autos unwohl fühlt, dann ist das sich Entfernen vom Auslöser oder das Entfernen des Auslösers dieses Verhaltens eine erleichternde Belohnung! Gerade im Training bei Angst- und Aggressionsverhalten ist das Arbeiten mit negativer Verstärkung eine wichtige Belohnung für erwünschtes Verhalten. Das Unangenehme für den Hund wird in diesem Fall nicht von der Bezugsperson hinzugefügt und dann wieder entfernt, sondern es kommt direkt aus der Umwelt.
KONSEQUENZ NUMMER 4 “POSITIVE VERSTÄRKUNG” (BEFRIEDIGENDE BELOHNUNG):
 Zeigt ein Hund ein Verhalten und diesem Verhalten wird etwas Angenehmes hinzugefügt, wird der Hund es häufiger zeigen. Belohnungen sind etwas Schönes und mit einem Gefühl der Freude verbunden. Der Botenstoff Dopamin, umgangssprachlich „Glückshormon“, spielt hier eine große Rolle. Je öfter der Hund eine angenehme Rückmeldung von seinem Menschen bekommt, welches Verhalten sich für ihn lohnt, desto häufiger wird er sich auch für das Verhalten entscheiden, welches der Mensch gerne häufiger sehen möchte. Und auch hier wirkt die klassische Konditionierung! All die schönen Momente kann das Gehirn des Hundes automatisch mit dem Menschen an seiner Seite und weiteren Dingen, die sich in den jeweiligen Situationen befinden, verbinden! Das ist eine tolle Nebenwirkung.
Zeigt ein Hund ein Verhalten und diesem Verhalten wird etwas Angenehmes hinzugefügt, wird der Hund es häufiger zeigen. Belohnungen sind etwas Schönes und mit einem Gefühl der Freude verbunden. Der Botenstoff Dopamin, umgangssprachlich „Glückshormon“, spielt hier eine große Rolle. Je öfter der Hund eine angenehme Rückmeldung von seinem Menschen bekommt, welches Verhalten sich für ihn lohnt, desto häufiger wird er sich auch für das Verhalten entscheiden, welches der Mensch gerne häufiger sehen möchte. Und auch hier wirkt die klassische Konditionierung! All die schönen Momente kann das Gehirn des Hundes automatisch mit dem Menschen an seiner Seite und weiteren Dingen, die sich in den jeweiligen Situationen befinden, verbinden! Das ist eine tolle Nebenwirkung.Je öfter der Hund erwünschtes Verhalten zeigt, da er gelernt hat, dass es sich für ihn lohnt, desto weniger Raum hat er, unerwünschtes Verhalten zu zeigen. Auf eine sehr nette Art und Weise ist man so in der Lage, dem Hund Grenzen zu setzen, da man ihm mit der angenehmen Rückmeldung für das Verhalten, welches der Mensch als erwünscht und belohnenswert empfindet, einen Handlungsrahmen schafft.
Egal ob Menschen, Hunde oder andere Tiere – alle sind im Leben einen Großteil damit beschäftigt, ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Daher ist es eine sehr natürliche und artgerechte Form des Trainings, sich diese Bedürfnisse im Training zu Nutze zu machen.
Leckerchen oder Futter sind nicht immer die optimale Belohnung, wenn man Verhalten auch verstärken möchte, damit es häufiger gezeigt oder erhalten wird. Möchte ein Hund gerne Wild hetzen und Sie möchten ihm zeigen, dass sich das Zurückkommen zu Ihnen lohnt, dann ist vielleicht ein kurzes Rennspiel oder ein Spielzeug an der Schnur, welches man über den Boden bewegen kann, eine viel bessere Belohnung. Die Chance, dass Ihr Hund beim nächsten Rückruf wieder freudig zu Ihnen kommt, ist somit sehr viel größer, da er weiß, dass Sie sein aktuelles Bedürfnis nach Bewegung in Form von Hetzen/Jagen befriedigen können.
Die Bezugsperson des Hundes ist ein wichtiger Teil in seinem Leben und wenn sie viel mit positiver Verstärkung trainiert, ein noch wichtigerer. Das heißt jedoch nicht, dass die Umwelt mit ihren vielen tollen Dingen nicht auch interessant sein kann und darf. Viele Bedürfnisse des Hundes werden im Alltag durch die Umwelt direkt befriedigt, wodurch Verhalten auch durch die Umwelt positiv verstärkt wird. Daher ist es wichtig, sich die Umwelt im Training ebenfalls zu Nutze zu machen. So wird Ihr Hund schnell zu einem kooperativen Partner, der Spaß und Freude an der Zusammenarbeit mit Ihnen hat. Dieses wiederum stärkt die Vertrauensbasis und die Bindung.
Ein weiterer Vorteil – das Training über positive Verstärkung löst kein Angst- und Aggressionsverhalten aus, da der Hund sich nicht bedroht fühlt.
Für die Hundehalter:innen ist der Start in diese Art des Trainings vielleicht etwas anstrengender als eine Klapperdose zu werfen oder an der Leine zu rucken, da sie ihren Hund beobachten müssen. Sie müssen ihn beobachten, um erkennen zu können, wann er erwünschtes Verhalten zeigt. Kurz bevor der Hund ins unerwünschte Verhalten fällt, gibt es den Moment des erwünschten Verhaltens, den man mit einer Belohnung noch verstärken kann! Auf der anderen Seite ist eine gute Beobachtung wichtig, um kreativ in der Gabe der Belohnungen zu werden.
FAZIT:
Egal welchen Konsequenzentyp man im Training anwenden möchte, um Einfluss auf das Verhalten des Hundes zu nehmen, muss man sich im Klaren darüber sein, dass letztendlich das Hundehirn darüber entscheidet, ob eine Konsequenz strafend oder verstärkend aufgenommen wird. Manche vom Hundehalter erdachte Strafe wird im Hundegehirn nicht als solche aufgenommen, sondern wirkt vielleicht nur irritierend, und manche gut gemeinte Belohnung kann strafend wirken, wenn beispielsweise die Körperhaltung des Menschen zum Zeitpunkt der Belohnung bedrohlich ausschaut.
Haben Sie einiges von den Beispielen der vier Konsequenzen der operanten Konditionierung im Fernsehen vielleicht schon einmal gesehen?
Oder haben Sie diese selber im Training mit Ihrem Hund angewandt? Alle Trainer:innen bedienen sich dieser vier Konsequenzen, egal mit welchen Worten sie ihre Trainingsmethode beschreiben. Worin sie sich unterscheiden ist die Häufigkeit, mit der sie die jeweiligen Konsequenzen einsetzen.
Es gibt Trainer:innen, die im Training mit dem Hund sehr häufig positive Bestrafung und negative Verstärkung einsetzen und sehr wenig positive Verstärkung in ihrem Programm haben. Das Ausbleiben einer Strafe ist für diese Trainer:innen oftmals Belohnung genug.
Andere Trainer:innen geben den Hunden häufig eine angenehme Rückmeldung und belohnen Verhalten. Außerdem ist es wichtig die Ursache von unerwünschtem Verhalten zu ergründen und zu beheben. Die Gesundheit und gute Haltungsbedingep mit ausreichend Bedürfnisbefriedigung spielen für einen nachhaltigen Trainingserfolg eine große Rolle.
Auch ist es wünschenswert, wenn Trainer:innen ihre Kund:innen so in Trainingssituationen führen, dass die Hunde auch die Chance haben, überwiegend erwünschtes Verhalten zeigen und somit angstfrei und stressarm lernen zu können, welches die Hundehalter:in dann positiv verstärken kann. Im Training sollte man Hund und Hundehalter:in nicht auflaufen lassen oder Fallen stellen, damit dann unerwünschtes Verhalten korrigiert und somit bestraft werden kann. Das ist dem Hund und auch dem Menschen gegenüber nicht fair und man hat Chancen vertan, erwünschtes Verhalten zu fördern.
Zeigt ein Hund unerwünschtes Verhalten, sollte dieses unterbrochen werden, denn jede Ausführung dieses Verhaltens wirkt wie ein Training. Möchte man Verhalten unterbrechen, wäre es auch da wünschenswert, wenn dieses möglichst ohne negative Nebenwirkungen geschieht. Hat man beispielsweise mit seinem Hund ein Zurückkommen, ein Sitzen oder Stoppen mit positiver Verstärkung trainiert, sind natürlich auch dieses sehr gute Abbruchsignale! Durch sie ist man sogar in der Lage, dem Hund eine Information darüber zu geben, was er statt es unerwünschten Verhaltens tun sollte. Das ist viel mehr wert als z.B. ein „Nein“, eventuell unterstützt mit Wasserspritzen, Rütteldosen oder einem Leinenruck.
Für mich als Hundehalterin und -trainerin ist es wichtig, dass ich durch meine Trainingsanleitung keine Angst steigere oder Aggressionen auslöse. Das Training muss so ablaufen, dass möglichst niemand zu Schaden kommt – weder Mensch noch Hund. Die Gefahr, dass Situationen eskalieren und der Hund seine Zähne einsetzt, wenn positive Bestrafung angewandt wird, ist mir einfach zu groß. Das Problem sind zum einen die Verletzungen, welche entstehen können. Zum anderen ist es nun mal so, dass die angegriffene Person zurück zuckt und der Hund mit seinem Verhalten auf jeden Fall Erfolg hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Zähne in der nächsten Situation wieder einsetzen wird, ist recht hoch.
Auch bei einem Hund, welcher bereits gelernt hat, dass der Einsatz von Zähnen ihn weiter bringt, kann ich keine Trainingstechnik anwenden, welche Aggressionen auslösen und Angst steigern könnten. Wo soll das hinführen?
Wird man von dem eigenen Hund angeknurrt oder sogar gebissen, ist das für viele Menschen extrem belastend und ich kann verstehen, dass sie ihm sagen möchten “So nicht, mein Freund…!”. Trainer:innen sollten versuchen ihre Kund:innen anzuleiten, in diesen Situationen über ihren Schatten zu springen und tatsächlich auch in kritischen Momenten mit Belohnungen und nicht mit Strafe zu arbeiten. Dieses ist möglich!
Managementmaßnahmen wie Maulkorb, Leine und Trenngitter (=Kindergitter) sind besonders bei Problemen mit Aggressionsverhalten wichtig, um besonnen im Training reagieren zu können und die Umwelt zu schützen. Erlangte Fertig- und Fähigkeiten werden mit dem Fortscheiten des Trainings Managementmaßnahmen nach und nach ablösen. “Leider” sind diese Methoden häufig nicht so dramatisch mit anzusehen und uninteressant für das Fernsehen. Training ist jedoch ein Prozess und dieser braucht Zeit!
Wenn es aber sichere Wege im Training gibt, warum sollte man auf ein Training zurückgreifen, welches zu einer Gefahr für Mensch und Hund werden könnte? Wie würden Sie entscheiden?
(Beitrag von 2018, aktualisiert im März 2025)