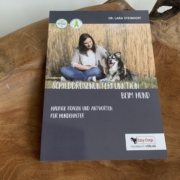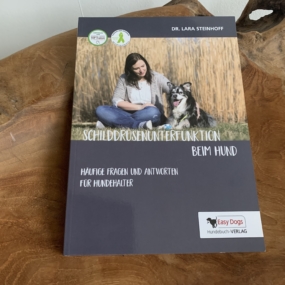Kann und soll man sich auf den Tod des Hundes vorbereiten?
Auf die großen Ereignisse des Lebens bereiten wir uns in der Regel vor und es gibt gesellschaftliche Normen und kulturelle Bräuche, die ihren Ablauf zu gestalten helfen: geboren werden, eingeschult werden, einen Abschluss machen, einen Partner fürs Leben finden, einen Partner verlieren, ein Kind bekommen. Es gibt Hochzeiten und Beerdigungen, Beileidsbriefe und Gratulationsideen, Geschenke und Geburtsvorbereitungskurse. Solche kulturellen Begleiter werden umso wichtiger, je weniger die Erfahrung vorhersehbar ist. Echte Grenzerfahrungen finden wir nicht nur im Gebirge oder beim Bungee-Sprung: Es ist nicht vorstellbar, wie es sich anfühlt, ein Kind zu bekommen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Es ist vorab nicht vorstellbar, wie es sich anfühlt, wenn einem der erste große Liebeskummer das Herz zerreißt.

Bilder: Miriam Arndt-Gabriel
Es ist nicht vorstellbar, wie es ist, wenn der eigene Hund nach Jahren des täglichen (und nächtlichen) Beisammenseins plötzlich nicht mehr da ist.
Das Seltsame ist: Wir wissen, dass dieser Moment kommen wird. Wir wissen es von dem Moment an, in dem wir das Hundebaby aus den Händen des Züchters übernahmen, kaum wussten, wie wir es halten sollen. Oder seit dem Moment, in dem sich eine Zwingertür schloss, ein Hundeherz gerettet schien. Wir wissen, dass Hunde kürzer leben als Menschen. Viele Hundehalter*innen haben den Schmerz schon einmal gespürt, den der Verlust eines Hundes bringt, und doch nochmal ihren Seelenfrieden riskiert.

Einige wissenschaftliche Studien zeigen mittlerweile, dass der Tod eines Hundes einen Menschen vergleichbar mitnimmt, wie der eines Angehörigen. Das ist kein Wunder, denn wir gehen intensive, emotionale Beziehungen zu unseren Hunden ein, verbringen teilweise sehr viel Zeit mit ihnen, organisieren unseren Alltag, unsere Reisen, unsere Freizeit nach ihren Bedürfnissen. Aber: Wenn ein Mensch stirbt, nimmt uns unsere Kultur an die Hand. Es gibt Bestatter, Beerdigungen, Trauerredner, Briefpapier mit schwarzem Rand im Schreibwarenladen, Trauer-Bouquets im Blumenladen, Grabsteine, Beileidsbekundungen, einen freien Tag vom Arbeitgeber, Friedhöfe, die man später besuchen kann und eine Anzeige in der Zeitung, damit es auch jeder weiß: Da ist einer gestorben, der wichtig war.

Als vor drei Wochen meine Hündin Habca starb, nach vierzehn gemeinsamen Jahren, ein Hund, ohne den ich nicht hier wäre, nicht die wäre, die ich heute bin. Ein Hund, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe, als mit irgendeinem Menschen, kurz: ein Hund, den ich über alles geliebt habe, und von dem ich mich geliebt gefühlt habe – da hätte ich gerne eine große Todesanzeige geschaltet. Da hätte ich gerne die Welt angehalten. Da hätte ich ein Orchester an ihr Grab bestellen mögen, das kitschige Lieder spielt und alle hätten schwarz tragen, mir die Hand geben und weiße Blumen in ihr Grab werfen sollen.
In meinem Umfeld gibt es keine Menschen, die Sätze zu sagen wagen, die mit „nur ein Hund“ zu tun haben. Als Selbständige habe ich mir selbst frei gegeben. Ich habe schon einmal einen Hund verloren, und ich habe mich als Philosophin mit dem Tod und Sterben befasst. Ich wusste seit Jahren, dass dieser Hund, meine engste Vertraute, nicht mehr lange leben würde. Und dennoch: Ich habe nicht gewusst, wie es sich dann wirklich anfühlen würde. Ohne sie. Ohne meinen schwarzen Schatten. Ohne das Langhaartier, das nie mehr als eine Armlänge von mir entfernt war. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es Realität. Jetzt fühle ich es, das Ohne-sie, das mich ganz durchdringt. “Trauer”, hat einmal jemand geschrieben, “ist nicht etwas, das man übersteht, das vorbeigeht, durch das man hindurch muss. Die Trauer wird ab jetzt immer da sein, sie wird sich nur verändern.” Dass das Ohne-sie jetzt für immer gelten soll, das ist das eigentlich Unfassbare.

Dennoch ist meine Trauer anders, als die um meine Hündin Nomi, die ich vor fünf Jahren innerhalb weniger Tage ganz überraschend und relativ jung gehen lassen musste. Damals habe ich gehadert: Ich hatte noch so viel vor mit ihr! Ich hatte so viel mit ihr an ihrer Artgenossenaggression trainiert, hatte sie auf ein Leben vorbereitet, das sie nun gar nicht mehr haben würde! Es war so unfair! Ich wünschte mir nichts mehr, als noch einmal einen Tag, eine Stunde mit ihr zu verbringen. Noch einmal über ihre weichen Ohren streichen.
Ich habe daraus gelernt. Als meine Habca aggressive Mammatumore hatte, und die Tierärztin sagte, es bliebe ihr nicht viel Zeit, beschloss ich, diese Zeit auszukosten. Mit Nomi blieben mir nur drei Tage, um sie mit allem zu verwöhnen. Mit Habca waren es drei Jahre, die uns noch geschenkt wurden. Ich begriff: Den Wert dieses Zusammenseins, den verstehen wir erst recht aus der Perspektive seiner Endlichkeit. Ich wollte den Tod nicht mehr verdrängen, ich wollte vorbereitet sein, ich wollte irgendwann sagen können: Wir haben dieses Leben gelebt, diese Partnerschaft, dieses Wunder von artübergreifender Liebe.
Wenn ich von Habcas Tod spreche, erfahre ich viel Mitgefühl, aber in den Augen all derer, die auch mit einem Hund leben, sehe ich auch den Schrecken: Wird mein Hund auch sterben? Ja, das wird er. Und ja:, es wird furchtbar sein.

Es tut weh, diesen Gedanken zuzulassen. Ich glaube aber, dass aus diesem Gedanken etwas Gutes entstehen kann. Das habe ich gemacht, um mich auf den Tod meines Hundes vorzubereiten:
- Ich habe jeden Tag eine Achtsamkeitsmeditation gemacht, indem ich mich für einen Moment ganz bewusst, ohne gleichzeitig etwas anderes zu tun, an der Gegenwart meines Hundes gefreut habe. Für mich passte das beim gemeinsamen Entspannen in der Mittagspause, wenn sie neben mir im Bett lag, ich manchmal ihren Atem spürte, oder sie leise schnarchen hörte. Dann sagte ich zu mir: “Das hier, genau das hier, das wirst du einmal unendlich vermissen. Nimm jetzt wahr, wie unendlich wertvoll dieser Augenblick ist.“ Jetzt habe ich so viele solcher kleiner Augenblicke, an die ich mich erinnern kann, in die ich mich körperlich hineinfühlen kann. Ich habe unser Zusammensein nicht verpasst.
- Ich habe Erinnerungen geschaffen. Ich habe Habca unendlich oft fotografiert, gefilmt, von anderen fotografieren lassen, über sie geschrieben, sie ein Bild mit ihren Pfoten malen lassen. Ich wollte nach ihrer Krebs-Diagnose unbedingt nochmal mit ihr in die Bretagne fahren: Wir waren noch dreimal dort, und es gibt so viele Fotos und Geschichten davon. Ich habe so viele schöne Bilder, aus denen ich jetzt welche auswählen kann, die ich vergrößere und aufhänge. Darüber bin ich so froh.
- Ich habe meine Prioritäten geklärt. Wenn die Zeit, die wir noch haben, endlich ist: Womit will ich sie verbringen? Schon mal nicht mit dem Herumärgern über ihr filzendes Haar, das können wir auch kurz schneiden. Nicht mit dem Abtrainieren von Nichtigkeiten, nicht mit Streit über Nebensächlichkeiten. Ich bin mit ihr gewandert, solange sie es konnte. Ich habe ihr Futter gegeben, das nicht nur gesund war, sondern das sie gern mochte. Wir waren vernünftig und manchmal auch nicht. Sie hatte ein gutes Leben, daran muss ich jetzt nicht zweifeln.
- Ich habe mir über ihren Tod Gedanken gemacht. Über das Drumherum, das Wie und Wo. Am Ende kam dann nicht alles so, wie ich es gern gewollt hätte, aber ich war vorbereitet. Wenn man schwanger ist, macht man einen Geburtsvorbereitungskurs und bestenfalls einen Geburtsplan, man überlegt sich zum Beispiel, welchen Interventionen man unter welchen Umständen zustimmen will. Man erfährt vielleicht erst einmal, dass man das selbst bestimmen kann (solange für niemanden Lebensgefahr besteht). Wenn ein Leben zu Ende geht, müssen oft plötzlich noch eine Reihe Entscheidungen getroffen werden, und das ist nicht unbedingt der Moment, in dem man richtig gut im Entscheiden ist. Gerade die Entscheidung für oder gegen Euthanasie bereuen Besitzer*innen im Nachhinein oft (egal, wie sie entschieden haben). Für mich war zum Beispiel klar: Ich werde dabei sein, wenn sie stirbt. Das war ich. Ich wollte gern, dass sie zuhause stirbt – das ging nicht, aber das konnte ich gut akzeptieren, denn ich hatte vorher in Ruhe darüber nachgedacht.
- Ich habe mir Gedanken gemacht, was mit ihrem Körper geschehen soll, und was ich für Erinnerungsgegenstände haben möchte. Auch hier: Geschockt vom Tod möchte man nicht unbedingt über Bestattungsvarianten nachdenken, es ist aber auch kein allgemein verbreitetes Wissen, was bei Tieren überhaupt möglich ist. Ich habe mich vor einigen Jahren damit befasst, und musste jetzt nicht darüber nachdenken. Ich wollte, dass Habca eingeäschert wird, und zwar alleine, nicht mit anderen Leichen zusammen, und dass ich die Asche am Ende bekomme. Die Tierklinik, in der Habca gestorben ist, arbeitet mit einem Bestatter zusammen, so war das ganz unkompliziert. „Ich fahre die Habca dann morgen da abholen“, sagte er am Telefon, und beschrieb, wo und wie er sie dann aufbewahre. Manchen Tierhaltern ist das vermutlich egal, aber vielleicht wacht man auch mitten in der Nacht auf und fragt sich: Wo ist ihr Körper jetzt? Bei Menschenleichen können wir uns eher darauf verlassen, dass mit ihnen achtsam umgegangen wird., Tierleichen können auch als Klinikmüll enden. Und obwohl der tote Körper nicht mehr der Hund ist, den ich geliebt habe, ist mir nicht egal, was mit ihm passiert. Ich fand es selbst früher befremdlich, wenn Leute ihre Tierurnen im Regal stehen hatten – als wir Nomis Asche vier Wochen nach ihrem Tod endlich beim Tier-Bestatter abholen konnten, war ich geradezu froh und mochte sie nie mehr hergeben (ursprünglich wollte ich sie verstreuen). Sie steht bis heute auf dem Kaminsims. Ich habe Habcas totem Körper im OP noch eine Haarsträhne abgeschnitten, die ich behalten habe. Daran hätte ich wahrscheinlich in dem Moment nicht gedacht, wenn ich es mir nicht vorher überlegt hätte. Aus Tierhaar kann man sich schöne Schmuckstücke fertigen lassen. Mit Nomi habe ich an ihrem letzten Lebenstag noch einen DNA-Test gemacht, weil es die letzte Gelegenheit und mir wichtig war. Vielleicht wollen Sie einen Pfoten- oder Nasenabdruck nehmen, manche Menschen bewahren auch einen Zahn auf oder vielleicht Dinge, die ich noch seltsamer finde – es sind kleine Krücken, um die Anwesenheit von jemandem, der gehen musste, noch zu spüren, und ich bin froh, dass ich jetzt eine Perle mit Habcas Haar an meinem Arm trage, ich stelle mir vor, dass sie mich beschützt in dieser schwierigen Zeit.
- Zuletzt beschloss ich noch, der Trauer den Raum zu lassen, den sie haben will, wenn es denn eines fernen Tages so weit sein würde. Ich beschloss, die Trauer nicht zu verdrängen, sondern als letztes Zeichen meiner Ehrerbietung für diesen wundervollen Hund, und die tiefe Partnerschaft, die uns verbunden hat, von dieser Trauer zu sprechen und zu schreiben. Ein kleiner ängstlicher Teil von mir schlug vor: “Hör jetzt schon auf, sie zu lieben, damit es später nicht so weh tut.“ – und ich entschied mich sehr bewusst dagegen. Ich entschied mich dafür, sehenden Auges und mit offenem Herzen auf diesen Schmerz zuzugehen, der da auf mich zukam. Ich beschloss, diese Trauer zu leben, mit allem, was sie mir bringen würde: mit der Wut, der Verzweiflung, dem Nicht-wahrhaben-wollen, der Leere, der Erinnerung, der Erleichterung, der Hoffnungslosigkeit, der Verwirrung, dem Schmerz, dem Trost, der Verlassenheit und der Anteilnahme. Für mich, für Habca und ein Stück für all die, die eine Zeugin brauchen, die ihnen sagt: Es ist okay und angemessen, so um einen Hund zu trauern. Denn das, was Mensch und Hund verbindet, ist unfassbar wertvoll.

Studien zeigen, dass Trauerbewältigung vor allem eins braucht: Soziale Unterstützung. Auch wenn mir anfangs gar nicht nach Kontakt zumute war, habe ich versucht, Freundinnen von meinem Schmerz zu berichten, und bin durchweg auf Verständnis gestoßen. Das muss gar nicht heißen, immer über den Tod zu sprechen: Eine Freundin las mir am Telefon Kinderbücher vor, eine andere sprach mit mir über komplizierte Fragen des Hundetrainings, und lenkte mich so ab. Wo Freundinnen so etwas nicht leisten können oder wollen, können Trauergruppen und Trauercafés helfen, die es auch auf Tiertrauer spezialisiert gibt. In Trauerforen im Internet schaut niemand komisch, wenn auch ein Jahr nach dem Verlust alles noch schwer erscheint.
Auch Bücher können helfen: Es gibt mittlerweile zahlreiche Publikationen zum Thema Tod des Haustiers, besonders nützlich erscheinen mir solche mit praktischen Übungen, wie “Abschied vom geliebten Haustier: 12×12 Anregungen zur Trauerbewältigung“ von Susann Scherschel oder “Abschied nehmen – Trauer um ein geliebtes Tier: Ein Begleit- und Praxisbuch“ von Eva Dempewolf, das einer geführten Trauergruppe mit sieben Sitzungen nachempfunden ist. Auch noch mehr Hilfe zu brauchen, ist kein Tabu-Thema mehr: Es gibt Trauerbegleiter (z.B. Heilpraktiker für Psychotherapie, Coaches), die sich auf Trauer um Tiere spezialisiert haben.